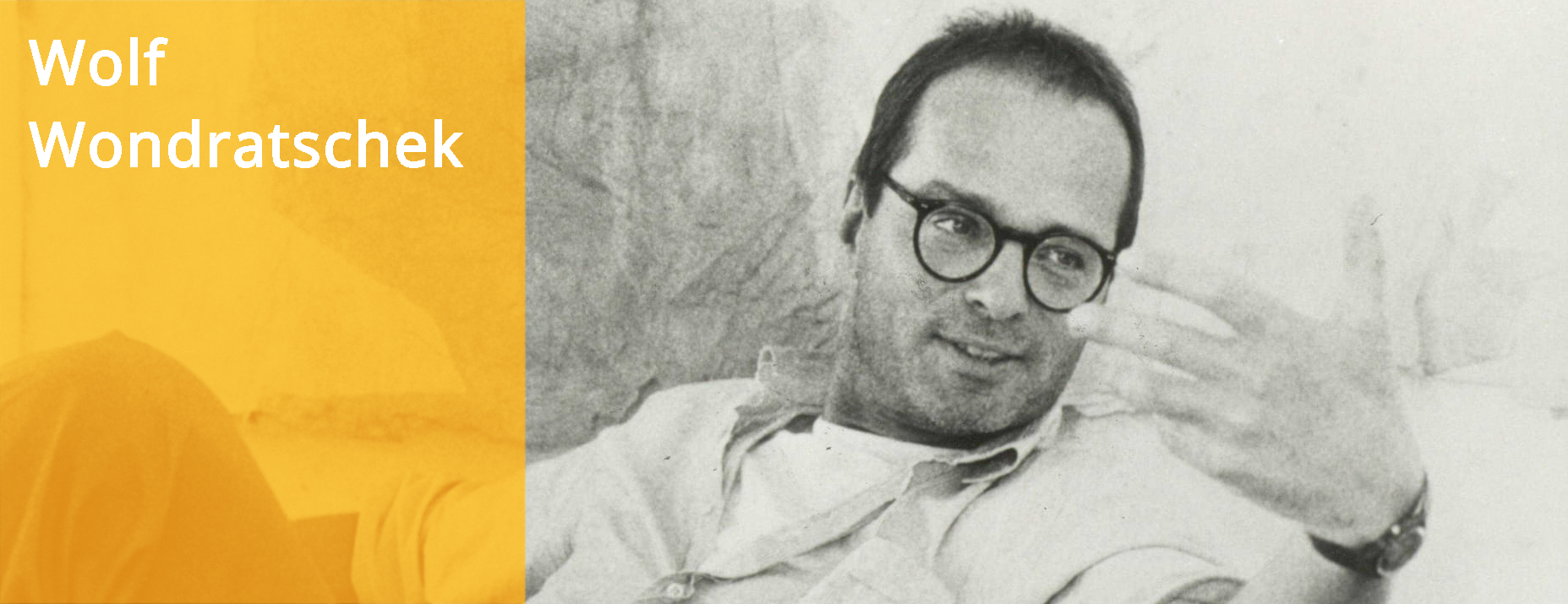Interview
Sie haben einmal gesagt, Sie würden es bereuen, nicht mehr geschrieben zu haben. Bereuen Sie es manchmal auch, nicht mehr aufgehoben zu haben?
Ich habe eher das Gefühl, wenn ich zurückblicke, zu viel geschrieben zu haben. Ich bezweifle heute, dass es nötig sein soll, immer fleißig sein zu wollen. Aber die Gabe, mit völliger innerer Zufriedenheit faul sein zu können, war mir zu meinem Bedauern nicht vergönnt. Leider. Vom Notwendigen nur das Nötigste zu Papier zu bringen, welch eine Tugend!
Und dass ich nicht mehr aufgehoben habe? Nein. Wozu soll das gut sein? Dass sich die Nachwelt darüber hermacht? Erste Fassungen, zweite, dritte aufbewahren wie Reliquien? Ist das nicht Eitelkeit, eine Selbstüberschätzung auch? Spuren tilgen. Schließlich zählt nur das Resultat, das fertige Manuskript. Der Weg dorthin ein Geheimnis. Da war ich nicht sehr konsequent. Man soll sich nicht in die Karten schauen lassen.
Kam die Idee, ein Archiv anzulegen, von Ihnen oder Herrn Meyerhuber und welche Gründe haben Sie zur Verwirklichung dieser Überlegung gebracht?
Es war eine gemeinsame Entscheidung. Herr Meyerhuber, da war ich sehr überrascht, als ich ihn kennenlernte, war seit Jahrzehnten ein Sammler meiner Sachen. Da dachte ich, nutze die Gelegenheit, das von mir aufbewahrte Material loszuwerden. Lebe mit leichtem Herzen und leichtem Gepäck. Weg damit. Hinterlasse keine vollen Schubladen.
Wenn Sie die Dokumente vergangener Lebensabschnitte vor sich sehen: Gibt es eine Schaffensepoche, in die Sie gerne zurückreisen würden?
Ab mit mir in die ewige Jugend meiner Zukunft.
„Kaffee, Zigarette und Schreibmaschine“ nannten Sie einmal Ihr Rüstzeug für die schriftstellerische Arbeit. Hat mittlerweile der Computer die Rolle der Schreibmaschine übernommen oder hat sich durch die neuen technischen Möglichkeiten sogar Ihre Arbeitsweise merklich verändert? Und daran anschließend: Können Sie uns ein wenig über Ihre Arbeitsweise verraten?
Ich habe Kaffee, Zigaretten und Schreibmaschine meine drei treuen Freunde genannt. Daran hat sich nur insofern etwas geändert, als ich meine Freunde gebeten habe, mich nicht zu überfordern. Der Computer bringt Erleichterungen mit sich, die ich als entspannend empfinde: problemlos korrigieren zu können zum Beispiel. Über meine Arbeitsweise kann ich keine vernünftigen Auskünfte geben. Nur so viel: absolute innere und äußere Ruhe, gute Laune, auf Überraschungen gefasst sein und darauf reagieren, ein erster Satz genügt, ein letzter wird sich finden, bis dahin mit dem Mut und der Einschätzung der eigenen Kräfte in gutem Einvernehmen bleiben.
Wollen Sie uns verraten, an welchen Projekten Sie derzeit arbeiten?
Das wäre ein unverzeihlicher Verrat.
Wann in Ihrem Leben hatten Sie den Wunsch, Schriftsteller zu werden?
Ich wollte nie ein Schriftsteller werden. Ich wünschte mir nur – und das schon sehr früh – ein Leben, das mir die Unabhängigkeit, Freiheit und Freude gönnt, zu schreiben.
Haben Sie ein Lieblingswerk?
Ich habe immer gelesen. Sozusagen querbeet. Mich haben alle Bücher – aus welchem Jahrhundert auch immer – interessiert. Ich kann noch heute mit dem Lesen nicht aufhören.
Überall liegen sie herum, angefangene Lektüren. Lesen bringt Interesse an der eigenen Arbeit. Es inspiriert. Mich interessiert nicht die Handlung. Es sind für mich Wörterbücher. Bücher liefern Material. Ich habe aus allem, was ich las, gelernt.
Sie sagten einmal, Sie würden sich wünschen, dass nach Ihrem Tod etwas gefunden wird, das zu einer grundlegenden Revidierung des Wolf-Wondratschek-Bildes führt. Denken Sie, dass ein solcher Fund im Meyerhuber-Wondratschek-Archiv gemacht werden kann?
Es wäre zu wünschen, es fände sich im Meyerhuber-Wondratschek-Archiv nach meinem Tod einiges, das den Leuten Respekt abverlangt.
Dass Sie 2015 das Manuskript zu Ihrem Roman „Selbstbild mit Ratte“ an einen Freund und Kunstmäzen verkauften und von der Veröffentlichung Ihres Werkes absahen, wurde kontrovers diskutiert. Können Sie die Kritik daran nachvollziehen?
Lassen Sie mich eine Bemerkung des von mir hoch geschätzten Dichters Ezra Pound zitieren: Gott bewahre mich vor la vie litteraire. Lieber mit einem alten Mann auf einer Bank sitzen, den Vögeln zuhören, Erinnerungen haben, ohne die Wahrheit in ihnen suchen zu wollen. Das literarische Gespräch oder die intellektuelle Debatte war für mich immer eine Zumutung. Genau wie es Verhandlungen mit Verlegern sind oder Interviews, die zu führen Verleger einem nahelegen. Ein Buch verkaufen müssen? Und daran auch noch handfest mitwirken müssen? Es genügt ein Enthusiast, um ein Werk zu rechtfertigen. Ein Glück, dass es für mich einen gab. Nichts daran ist elitär.
Manche Kritiker behaupten, dass die Erzählungen und Gedichte, mit denen Sie in den 1970er Jahren berühmt wurden, heute bereits reichlich verstaubt seien. Was empfinden Sie selbst, wenn Sie heute Ihre frühen Werke lesen?
Ich kann auf keinem meiner frühen Gedichte auch nur eine Flocke Staub entdecken. Hin und wieder lese ich sie ja auch noch vor Publikum. Das hält alles noch in aller alten Frische stand. Die Kritiker, von denen Sie reden, müssen Sie erfunden haben.
Sie wurden bereits als Student quasi über Nacht zu einem der bekanntesten deutschen Schriftsteller. Was hat der frühe Erfolg bei Ihnen bewirkt? Denken Sie, dass Sie bei ausbleibendem Erfolg nach einer anderen Beschäftigung Ausschau gehalten hätten?
Ich hätte nie aufgegeben. Es gibt kein Scheitern, wenn man ein Leben lang Zeit hat, aus Niederlagen die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Wann wird das Schreiben für Sie zum Drang, wann kostet es Sie Überwindung?
Man muss warten können, die Stunde abwarten, wenn die Luft rein, der Mond nicht zu hell und die Arbeit mit der Sprache ein unendliches, nie ganz zu verstehendes Vergnügen ist.
Sie finden unglückliche Menschen interessanter als glückliche Menschen. Halten Sie sich selbst für einen (eher) unglücklichen Menschen?
Die erste Zeile eines kurzen, noch unveröffentlichten Gedichts von mir lautet: „Ich bin, was ich nie werden wollte, glücklich.“ Ich bin einverstanden. Von der Unruhe in mir zu reden verbietet sich. Sie ist jedem möglichen Unglück sehr nahe.